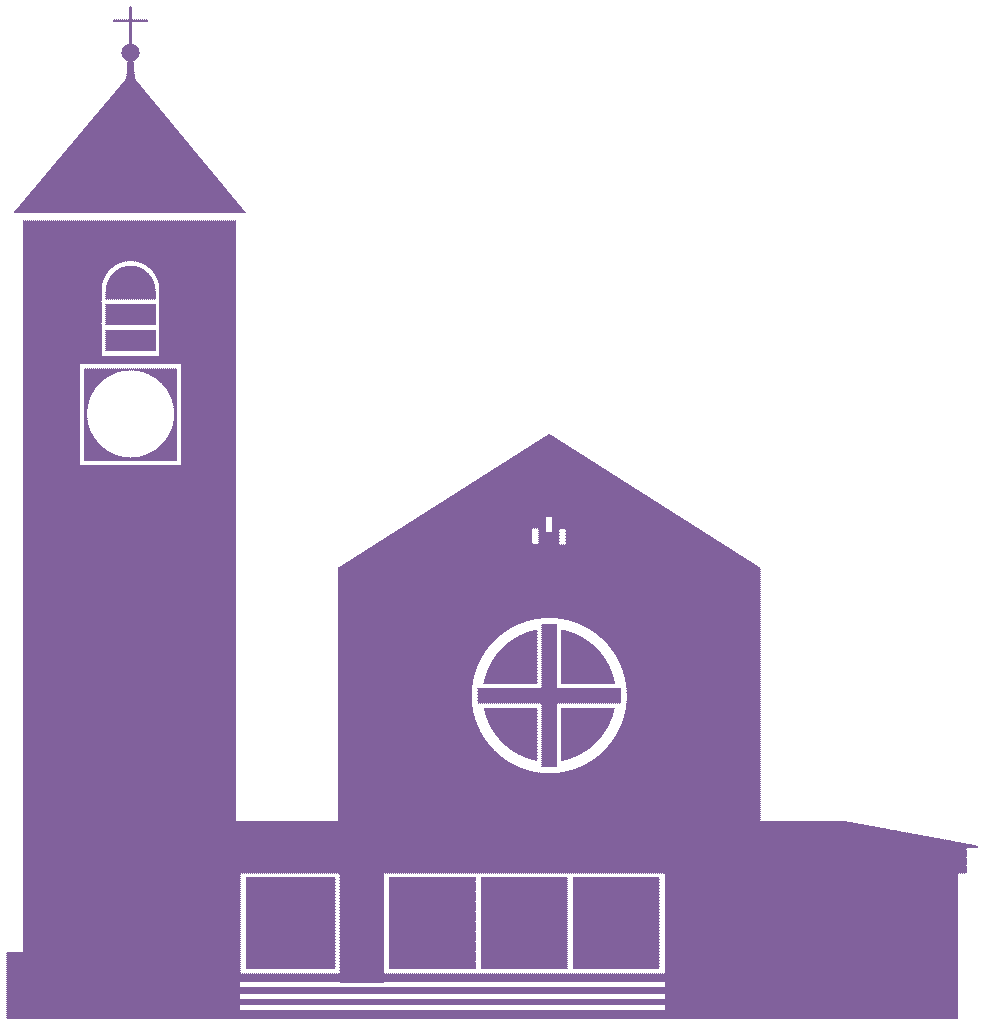Jedes Mitglied des Kirchenbauvereins verpflichtete sich, pro Jahr mindestens eine Reichsmark als Beitrag in die Vereinskasse zu leisten und der Verein sparte, um möglichst bald mit dem Kirchenbau beginnen zu können. Im Jahr 1898 schenkte die Stadt Hof dem Kirchenbauverein das Grundstück an der Oelsnitzer Straße 8 als Baugelände für die neue Kirche. Für den Neubau reichte das Geld zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber die Pfarrstelle konnte besetzt werden. Die ersten Pfarrer im Vertl hatten ein schweres Amt übernommen. Keine Kirche, kein Gemeinderaum stand zur Verfügung. Im Haus Jaspisstein 28 hatte die Baumwollspinnerei der jungen Kirchengemeinde einen Saal zur Verfügung gestellt. .........
Kirchengeschichte von St. Johannes
Die Kirchengemeinde St. Johannes Hof - Entwicklung und Geschichte
Noch vor ca. 180 Jahren war unser "Vertl" völlig unbebaut; es bestand nur aus Äckern und Wiesen. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts änderte sich das Bild. Die erste Eisenbahnlinie wurde gebaut und Hof entwickelte sich zur Industriestadt. 1853 entstand die erste Spinnerei und in schneller Folge wurden entlang der Saale weitere Textilbetriebe gebaut. Viele Menschen zogen nach Hof und fanden in den neuen Fabriken Arbeit und Brot. Die ersten Häuser in der Ottostraße, Luisengasse und Weberstraße wurden gebaut - die Fabrikvorstadt von Hof war entstanden. Wohnungen, Fabriken, Läden und Wirtshäuser, das gab es nun im Vertl, aber keine Kirche. Und je mehr Menschen sich in der Fabrikvorstadt ansiedelten, desto wichtiger wurde die Frage, wie man all diese Menschen geistlich betreuen könnte.
Deswegen gründete die Evangelische Kirchengemeinde Hof - es gab damals noch keine einzelnen Pfarreien - am 26. April 1897 einen Verein. Und dieser Verein steht am Anfang der Kirchengeschichte von St. Johannes, denn der erste Paragraph seiner Satzung hatte folgenden Wortlaut:
"Er bezweckt, der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Hof eine Kirche und die dazu gehörigen Wohnungen für Geistlichen und Mesner in der Fabrikvorstadt zu erbauen."
Jedes Mitglied des Kirchenbauvereins verpflichtete sich, pro Jahr mindestens eine Reichsmark als Beitrag in die Vereinskasse zu leisten und der Verein sparte das Geld zusammen, um möglichst bald mit dem Kirchenbau beginnen zu können.
Der Stadtrat von Hof versprach am 14. Oktober 1898 dem Kirchenbauverein, ihm das Grundstück Oelsnitzer Straße 8 als Baugelände für die neue Kirche zu schenken. Bis zum Jahr 1911 hatte der Kirchenbauverein 80 000 Mark zusammengespart.
Das reichte nicht, um mit dem Bau der Kirche zu beginnen. Aber etwas viel Wichtigeres tat der Verein: Die Kirchengemeinde wollte einen 6. Pfarrer in Dienst nehmen, der für die Seelsorge in der Fabrikvorstadt zuständig sein sollte. Das Geld reichte aber nicht, um diesen Plan auszuführen. Deshalb beschloss der Kirchenbauverein, einen Teil der Miete für die Wohnung des neuen Pfarrers aus der Vereinskasse zu bezahlen und ermöglichte so die Anstellung des neuen Geistlichen.
Am 1. September 1911 war es dann soweit: Als erster Pfarrer im Fabrikviertel trat Wilhelm Reichardt aus Feuchtwangen seinen Dienst an. Sein Nachfolger – als er nach Memmingen ging – wurde Christian Dietrich aus Bayreuth am 1. September 1913 installiert.
Nachdem Pfarrer Dietrich nach St. Lorenz berufen wurde, übernahm am 3. September 1916 Pfarrer Christoph Schmidt aus Hohenberg sein bisheriges Amt.
1920 wurde Pfarrer Schmidt an die Hospitalkirche berufen und fünf Jahre lang wurde die Fabrikvorstadt von Hilfsgeistlichen versorgt: von 1920 bist 1923 von Ernst Hübner, und anschließend von Adolf Häffner.
Die ersten Pfarrer im Viertel hatten ein schweres Amt übernommen. Keine Kirche, kein Gemeinderaum oder Ähnliches stand zur Verfügung. Im Haus Jaspisstein 28 hatte die Baumwollspinnerei einen Kindergartensaal eingerichtet. Diesen Raum stellte sie an den Abenden und Sonntagen der jungen Kirchengemeinde zur Verfügung.
Bald entfaltete sich ein reges kirchliches Leben. Jeden Sonn- und Feiertag wurden Bibelstunden gehalten; der Konfirmandenunterricht wurde eingerichtet, der Jungfrauenverein und der Mädchensingkreis gegründet und ehrenamtliche Gemeindehelferinnen besuchten die Kranken und Alten der Gemeinde.
Aber noch immer fehlte das eigene Gotteshaus. Der Kirchenbauverein hatte mittlerweile
150 000 Mark zusammengespart und der Kirchenbau schien in greifbare Nähe gerückt. Dann kam die Inflation und die mühsam gesammelten Spenden waren verloren; an eine Kirche im Viertel war nicht mehr zu denken. Zu allem Unglück beschloss auch noch die Neue Baumwollspinnerei, den Kindergarten industriell zu nutzen und die Kirchengemeinde war völlig heimatlos geworden.
Die Familie Schaller aus der Luisengasse sprang in die Bresche und stellte ihr großes Wohnzimmer zur Verfügung, damit die Bibelstunden nicht ganz ausfallen mussten, bis dann nach einiger Zeit der Kindergarten wieder zur Verfügung stand.
Am 1. April 1925 wurde ein Mann als Pfarrer für die Fabrikvorstadt berufen, dessen Name untrennbar mit der Geschichte unserer Johanneskirche verbunden ist: Pfarrer Wilhelm Heerdegen.
Am 6. September 1891 in Hof geboren, ging er hier ins Gymnasium, studierte in Erlangen, Heidelberg und Leipzig, wurde Hilfsgeistlicher in St. Lorenz und der Hospitalkirche und war dann als Religionslehrer tätig, bevor er am Palmsonntag 1925 als Pfarrer installiert wurde.
Und Pfarrer Heerdegen wurde gleich aktiv. Er wollte eine Kirche für sein Viertel; und wenn schon nicht genug Geld für eine Kirche vorhanden war, dann sollte wenigstens sofort ein Gemeindehaus gebaut werden. Er sammelte Geld, verhandelte mit dem Kirchenbauverein, mit dem Stadtrat, dem Landeskirchenrat, dem Kreisdekan, usw. Und er schaffte es: am 23. November 1925 beschloss die Evang.-luth. Kirchenverwaltung den Bau eines Gemeindesaals mit Pfarrwohnung.
Der Augsburger Architekt E. Gesswein entwarf den Bauplan und 1926 begannen die Firmen Schrenk und Klee mit den Bauarbeiten. Die Firma Steinmeyer, Oettingen, baute die Orgel; namhafte Künstler wie der Bildhauer Prof. Pfeiffer aus München, die Maler Frobenius aus Nürnberg und Max Hofmann aus Hof übernahmen die künstlerische Ausgestaltung des Gemeindesaals. 1927 wurde das Werk vollendet, das Fabrikviertel hatte endlich einen geistlichen Mittelpunkt.
Am 1. Sonntag nach Trinitatis, am 29. Juni 1927, wurde das Gotteshaus feierlich eingeweiht. Der Kreisdekan, OKR Prieser aus Bayreuth, hielt die Festpredigt und übergab das Johanneshaus an den ersten Inhaber der neuen Pfarrstelle, Pfarrer Heerdegen. Den Abschluss dieses großen Tages für das Viertel war ein Familienabend. Menschen nicht nur aus dem Viertel, sondern aus ganz Hof kamen und feierten mit.
Das neue Gebäude war aber kein Haus, das man nur von außen ansah, sondern es wurde benützt: Pfarrer Heerdegen und der Kirchner Hans Seidel bezogen die Wohnungen im Johanneshaus, der Kindergarten wurde eröffnet. Hans Dannhorst nahm seine Arbeit als Organist und des Kirchenchores auf, der Arbeiterinnenverein unter Leitung von Frau Heerdegen entfaltete eine segensreiche Tätigkeit und ehrenamtliche Helfer kümmerten sich verantwortungsvoll um die Jugend der Gemeinde.
1929 pachtete der Arbeiterinnenverein in Sichersreuth bei Wunsiedel einen Bauernhof. Bis zum Ende des 2. Weltkrieges fanden dort, betreut von der Hausmutter Katharina Unglaub, viele Menschen aus dem Viertel Erholung und innere Stärkung.
So war das Johanneshaus innerhalb kurzer Zeit der Mittelpunkt einer lebendigen Gemeinde geworden. Nur eines fehlte noch: die Glocken!
Bis 1935 hatte die Gemeinde das Geld zusammengebracht und beauftragte die Glockengießerei Schilling in Apolda [„Franz Schilling Söhne“] mit dem Gießen von 4 Glocken. 1936 wurden die Glocken nach Hof gebracht und vorerst im Vorraum des Johanneshauses aufgestellt, denn es fehlte noch der Turm. Erst nach einem Jahr konnte der Turm nach einem Entwurf des Architekten Claasen, Coburg, von der Baufirma Erwin Graß errichtet werden. Am 1. Advent 1937 (28.11.1937) riefen die Glocken zum ersten Mal die Johannesgemeinde in das Haus ihres Herrn.
Die Freude über die nun vorhandenen Glocken währte allerdings nicht sehr lange. Der Weltkrieg kam und die 3 großen Glocken mussten abgeliefert werden und wurden zu Kanonen verarbeitet. Nur die kleinste, die Taufglocke, durfte im Krieg noch zum Frieden rufen.
Aber die Machthaber des 3. Reiches hatten es nicht nur auf die Glocken abgesehen: auch die Menschen wollten sie aus der Kirche vertreiben. Reichsbischof Müller und seine „Deutschen Christen“ versuchten die evangelische Kirche zu spalten. Aber fast alle Gemeindeglieder schlossen sich der bekennenden Kirche an und besuchten trotz Propaganda weiter ihre Gottesdienste. Mit allen nur erdenklichen Schikanen wurde dem Pfarrer und seinen Mitarbeitern die seelsorgerliche Tätigkeit schwer gemacht. Der Treue seiner Gemeinde hatte es Pfarrer Heerdegen zu verdanken, dass er nicht ins Gefängnis oder ins KZ kam.
277 Männer aus der Gemeinde waren im Krieg gefallen, 78 waren vermisst, 30 Gemeindeglieder starben beim Bombenangriff am 14. Februar 1945, der 9 Häuser in der Leimitzer- und Gabelsbergerstraße vernichtete.
In dieser Zeit verhängte die nationalsozialistische Kreisleitung über Pfr. Heerdegen ein Redeverbot. Aber Pfr. Heerdegen hat sich nicht daran gehalten. Schließlich wurde Pfr. Heerdegen zum Militär eingezogen.
Während seiner Abwesenheit betreute von 1940 – 41 Pfr. Karl Ermann aus Erbendorf und von 1941 – 44 Pfr. Ludwig Krämer aus Tirschenreuth die verwaiste Pfarrstelle.
Nach dem Kriegsende und dem Zusammenbruch des Dritten Reiches normalisierte sich langsam das öffentliche und geistliche Leben wieder.
1947 war für die St. Johannesgemeinde wieder ein sehr wichtiges Jahr; denn bis dahin bestand ganz Hof nur aus einem einzigen Pfarrsprengel. Am 1. April 1947 wurde die Stadt in sieben Pfarreien aufgeteilt. Und seit diesem Zeitpunkt war St. Johannes eine selbständige Kirchengemeinde. Trauungen und Taufen der Gemeindeglieder fanden nun in der Johanneskirche statt und nicht mehr, wie bis dahin, in St. Michaelis.
Ein eigener Kirchenvorstand wurde gewählt und Herr Adam Weidner wurde zum Kirchenpfleger bestellt. Frl. Unglaub, die frühere Hausmutter in Sichersreuth, trat den Dienst als Pfarrgehilfin an. Als erster Kirchner und Hausmeister begann Herr Luitpold Strobel seinen Dienst.
Der Rummelsberger Diakon Albert Kaerner war zu dieser Zeit Kantor in St. Johannes; er trat diesen Dienst 1938 als Nachfolger von Hans Dannhorn an. 1952 wurde Albert Kaerner nach Augsburg versetzt; seine Nachfolge trat Max Littke an, der bis zum Jahre 1959 den gesamten Kirchenmusikdienst in St. Johannes ausübte.
Nachdem die Einwohnerzahl im Fabrikviertel laufend gestiegen war, wurde eine Vikariatsstelle eingerichtet. Vikar Fritz Fischer war der erste, der am 01.08.1949 seinen Dienst antrat.
Die Vikare wohnten damals noch in der Sedanstraße. Am 01.06.1954 trat Vikar Fritz Weise die Nachfolge seines Vorgängers an. Nach dessen Versetzung übernahm Klaus Uhrlau das Vikariat.
Ein denkwürdiger Tag in der Geschichte unserer Gemeinde ist der 01.09.1949: Im Haus Jaspisstein 6 wurde eine Diakoniestation eingerichtet. Die Neuendettelsauer Schwester Helene Windisch trat ihren entsagungsvollen Dienst an Alten, Kranken und Armen an. Diesen Dienst tat sie bis zu ihrer Pensionierung im Jahre 1970.
Noch immer war nur eine Glocke im Turm der Johanneskirche; und die ließ die Gemeinde nicht ruhen. Es wurde fleißig gesammelt und gespendet und 1955 war das Geld für neue Glocken beisammen. Drei Glocken wurden von der Firma Schilling in Heidelberg [Friedrich Wilhelm Schilling] gegossen und am 18. Dezember 1955 ertönte dann endlich wieder das Parsivalmotiv der Glocken von St. Johannes.
1956 traf die Kirche eine unerwartete Heimsuchung. Am Samstag, den 18. Februar, brach auf dem Dachboden der Kirche ein Feuer aus. Zwanzig Meter hohe Flammen schlugen zum Himmel. Die alarmierte Feuerwehr kämpfte aufopferungsvoll, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Es war sehr kalt und die Hydranten waren eingefroren, so dass eine 2,5 km lange Schlauchleitung von der Saale bis in die Oelsnitzer Straße gelegt werden musste. Nach 75 Minuten gelang es den 35 Feuerwehrmännern das Feuer einzudämmen. Die restlichen Lösch- und Aufräumungsarbeiten nahmen noch viele Stunden in Anspruch.
Das Feuer hatte den Dachstuhl vernichtet und es bestand die Gefahr, dass die Orgel und der Parkettboden der Kirche vernichtet worden war. Ungerufen erschienen zahlreiche Helferinnen und Helfer mit Eimern, Lappen und Besen bewaffnet, um das Wasser aus dem Kirchenschiff zu entfernen. Dadurch konnte ein noch größerer Schaden verhindert werden. Während der Reparaturarbeiten mussten die Gottesdienste im Kindergartensaal stattfinden. Am 1. Pfingstfeiertag konnte die Kirche wieder eingeweiht werden.
Anfang der fünfziger Jahre begann eine Entwicklung, die bis heute noch nicht abgeschlossen ist: Die Häuser im eigentlichen Fabrikviertel waren nicht mehr zeitgemäß. Moderne Mietshäuser wurden errichtet und viele bauten sich ein eigenes Haus außerhalb der Stadt. Im Viertel nahm die Seelenzahl ab, während sie vor allem in Tauperlitz ständig zunahm. Daher wurde es dringend erforderlich, die seelsorgerliche Arbeit in dieser Gemeinde zu verstärken.
Gottesdienste fanden zwar regelmäßig in der Tauperlitzer Schule statt, die vom Lehrer Walter Fischer musikalisch ausgestaltet wurden, aber das reichte nicht mehr aus, Tauperlitz brauchte eine eigene Kirche. Am 22. September 1957 wurde daher der Kirchenbauverein Tauperlitz gegründet. Am 13. Oktober 1958 wurde der erste Spatenstich getan und am 6. Dezember 1958 der Grundstein für die Erlöserkirche gelegt. Die Baufirma Max Peetz aus Zedwitz begann mit dem Kirchenbau nach den Plänen von Architekt Heinz Rudorf aus Hof. Die Glocken für die Erlöserkirche goss die Glockengießerei Schilling in Apolda. 1959 war der Kirchenbau vollendet. Am 1. November 1959, dem Reformationstag – wurde die Erlöserkirche unter großer Anteilnahme der ganzen Bevölkerung vom Kreisdekan OKR Burkert aus Bayreuth geweiht.
Nun war die schöne Kirche da, aber es fehlte noch eine Orgel; denn dafür hatte das Geld nicht gereicht. Ein Harmonium begleitete den Gemeindegesang. Darum beschloss man am 13. März 1960 die Gründung eines Freundeskreises für die Anschaffung einer Orgel. Die musikalische Gestaltung der Gottesdienste in der Erlöserkirche lag in den Händen des Organisten von St. Johannes; zu dieser Zeit war es Max Littke. Die Nachfolge nach seiner Pensionierung übernahm ein Hofer Musiker: Franz Finsel. Zunächst übernahmen auch die Kirchner von Tauperlitz alle Aufgaben eines Gemeindehelfers. Diesen wertvollen Dienst versah anfänglich Frau Krauß und nach deren Tod ihre Tochter, Frau Kinzel.
Nicht nur in Tauperlitz wuchs die Seelenzahl, sondern auch in Leimitz/Jägersruh. Seit 1925 wurden in der dortigen Schule regelmäßig Gottesdienste gehalten, was aber immer nur als Übergangslösung gedacht war. Deswegen beschloss der Kirchenvorstand 1960, in Jägersruh ein Grundstück zu erwerben, um später einmal hier ein Gemeindezentrum zu errichten. Bis heute hat sich dieser Plan leider nicht verwirklichen lassen und so ist aus der Übergangslösung eine „Dauerlösung“ geworden: denn bis zum Jahre 2000 fanden noch alle 14 Tage Gottesdienste in der Schule statt.
Das Jahr 1961 war geprägt durch personelle Veränderungen: Frau Unglaub trat in den Ruhestand, ihre Nachfolgerin als Pfarramtsgehilfin und später Pfarramtssekretärin wurde Frau Marie Harles. Vikar Klaus Uhrlau übernahm eine eigene Pfarrstelle und Peter Zeisler aus Nürnberg übernahm das Vikariat in St. Johannes. Die Gemeinde erhielt eine 2. Pfarrstelle und aus Bad Reichenhall kam Pfr. Rainer Firck und wurde am 26. Februar als zweiter Pfarrer installiert. Am 30. September trat Kirchenrat Wilhelm Heerdegen in den wohlverdienten Ruhestand, verwaltete aber das Pfarramt noch bis Mai 1962. Sein Nachfolger als 1. Pfarrer von St. Johannes wurde der gebürtige Nürnberger Walter Haas. Am 10. Juni 1962 – dem Pfingstmontag – wurde er in sein neues Amt eingeführt.
Pfarrer Haas führte gleich eine wichtige Änderung im gottesdienstlichen Leben der Gemeinde ein: Bisher fanden zwei Gottesdienste statt, um 8.00 Uhr in St. Johannes und um 9.30 Uhr in Tauperlitz. Ab 1962 gab es nun den Predigtgottesdienst um 8.00 Uhr in St. Johannes und um 9.30 Uhr in beiden Kirchen den Hauptgottesdienst mit anschließendem Kindergottesdienst. Die Folge war, das für Tauperlitz ein eigener Organist benötigt wurde. Ein sechzehnjähriger Junge übernahm diesen Dienst: Günter Strobel, der Sohn der Kirchnerleute von St. Johannes. Ab 1984 leitete er auch den neugegründeten Kirchenchor der Erlöserkirche.
Eine weitere Möglichkeit zum Gottesdienstbesuch boten ab 1963 die Abendgottesdienste in St. Johannes, die jeweils im Sommerhalbjahr stattfanden, und die damals mit großem Erfolg abgehaltenen Bibelwochen.
Im Jahre 1964 wurde endlich eine Arbeit in Angriff genommen, die schon lange notwendig geworden war: der Umbau von St. Johannes zum Gemeindezentrum. Das im Jahr 1925 erbaute Haus war damals ja nur als Betsaal mit Pfarrerwohnung gedacht gewesen. Nun endlich musste der Gemeindesaal in einen richteigen Kirchenraum gestaltet werden. Außerdem entsprachen Kindergarten und Nebenräume in Größe und Ausführung nicht mehr den modernen Anforderungen. Zuerst wurde der Neubau des Kindergartens errichtet und 1965 eingeweiht. In drei Gruppenräumen, mehreren Nebenräumen und drei Spielplätzen konnten nun 110 Kinder betreut werden. Die alte Kinderkrippe im jetzigen Lutherzimmer bot kaum für 35 Kinder Platz.
Bis 1966 dauerten die Bauarbeiten in St. Johannes, dann war es endlich geschafft: am 1. Advent fanden mit einem Festgottesdienst und einem Kirchenkonzert Umbau und Erweiterung des Gemeindezentrums St. Johannes ihren fröhlichen Abschluss. Aus dem alten Gemeindesaal war ein heller, freundlicher Kirchenraum geworden, um dessen Mittelpunkt Altar und Kanzel sich die Gemeinde halbkreisförmig sammelt. Aus der alten Kinderkrippe im Keller war das Lutherzimmer geworden; unter dem Dach stand nun ein großer Raum für Jugendgruppen zur Verfügung; der Kirchenvorstand konnte seine Sitzungen im Löhezimmer halten und im Erdgeschoss war das Pfarramtsbüro eingerichtet worden.
Im gleichen Jahr hatte auch der Freundeskreis in Tauperlitz sein Ziel erreicht: Am 31. Juli 1966 wurde die neue Orgel – gebaut von der Firma Köberle aus Schwäbisch-Gmünd – feierlich eingeweiht. Gleichzeitig wurden die Konfirmanden von einer Pflicht befreit: eine elektrische Läuteanlage nahm ihnen die Arbeit des Glockenläutens ab.
1967 war wieder ein Jahr personeller Veränderungen: Vikar Reinhard Tallner erhielt eine eigene Pfarrstelle; sein Nachfolger wurde Vikar Reinhard Kube. Auch Pfarrer Firck bekam eine Stelle in Dachau; die 2. Pfarrstelle blieb ein halbes Jahr unbesetzt.
Im gleichen Jahr erschien zum ersten Mal der Gemeindebrief von St. Johannes und informierte die Einwohner des Viertels über die kirchlichen Veranstaltungen.
Am Pfingstmontag, den 3. Juni 1968 konnte die 2. Pfarrstelle wieder besetzt werden: Pfarrer Hans Stettner wurde als 2. Pfarrer von St. Johannes installiert.
Nach Jahren des Bauens von Gebäuden wurde nun am Bau einer lebendigen Gemeinde begonnen. Die Bibelstunden alter Ordnung wurden ersetzt durch zwei Seniorenkreise; ein Kreis von jugendlichen Mitarbeitern für den Kindergottesdienst wurde aufgebaut; die Feier der silbernen Konfirmation eingeführt und ganz erfreulich war die Zunahme der Zahl der Teilnehmer am Heiligen Abendmahl, die sich fast verdoppelte.
1970 trat Reinhardt Kube eine eigene Pfarrstelle in Tettau an; Nachfolger im Vikariat wurde Gerhard Strunz; neben seinen sonstigen Pflichten übernahm er auch die Leitung des Kirchenchores in Tauperlitz, weil der bisherige Leiter, Günter Strobel, nach Starnberg verzog. Organistin an der Erlöserkirche wurde Frau Ursula Hofmann. Auch im Organistendienst in St. Johannes gab es eine Veränderung: Oberlehrer Paul Ernst wurde Organist und Kantor als Nachfolger von Adolf Finzel.
Am 16. Januar 1971 wurde das von der Gesamtkirchenverwaltung errichtete Gemeindehaus in der Gabelsbergerstraße eingeweiht. Es dient fortan für die Kirchengemeinden St. Johannes und Hospital. Endlich stand damit für die verschiedenen Arbeiten und Angebote im 2. Sprengel ein geeigneter Raum zur Verfügung.
Ein bedeutendes Jahr für das Gemeindeleben war das Jahr 1972. Am 24. September fand der erste Gemeindetag von St. Johannes statt, eine moderne Form, die christliche Gemeinschaft zu festigen und zu beleben. Auch im Kindergottesdienst wurde eine neue Form eingeführt. Die Form des bisherigen Kindergottesdienstes fand bei den Kindern keinen Anklang mehr. Erst mit der Einführung einer neuen Liturgie und zeitgleich mit dem Hauptgottesdienst im Lutherzimmer, geleitet von Günter Krauß, wuchs die Begeisterung bei den Kindern sprunghaft. 70 Teilnehmer am Kindergottesdienst waren in diesen Jahren keine Seltenheit.
Am 30. November 1972 trat der altgediente Kirchner von St. Johannes, Luitpold Strobel, in den wohlverdienten Ruhestand. Als Nachfolger trat Erich Bormann, der 2. Vorsitzende des Hofer CVJM, den Dienst als Kirchner und Hausmeister an.
1974 bekam St. Johannes eine neue Orgel. Die alte hatte nach und nach ihren Geist aufgegeben, so dass sie kaum mehr bespielbar war. In einem freiwilligen Arbeitseinsatz wurde von den Kirchenvorstehern das alte Instrument abgerissen und die Firma Ismayer, Bernried, baute die neue Orgel ein. Am 22. Mai wurde sie in einem feierlichen Abendgottesdienst eingeweiht. Die neue Orgel wurde auch gleich von einer neuen Organistin gespielt. Paul Ernst ging in Pension und Frau Helga Hohenberger trat die Nachfolge als Organistin und Kantorin von St. Johannes an.
Im gleichen Jahr übernahm in Tauperlitz Frau Sigrid Stadelmann die Leitung des Kirchenchores, da Vikar Gerhard Strunz eine eigene Pfarrstelle in Röslau bekam. Das freigewordene Vikariat übernahm der Missionsvikar Gerhard Neumeister.
1974 tat dann endlich auch wieder eine Gemeindeschwester in der Gemeinde Dienst: Margarete Kellermann. Am 31. März 1975 trat Frau Harles in den Ruhestand und Frau Lore Gärtner trat das Amt der Pfarramtssekretärin an. Im gleichen Jahr heiratete die Organistin Frau Hofmann und zog nach Rehau; ihr Nachfolger in Tauperlitz wurde Adolf Finzel.
Ein weiterer Personalwechsel erfolgte: Pfarrer Walter Haas, der Gründer unseres Gemeindezentrums, übernahm am 1. September 1975 eine Pfarrstelle in Garmisch-Grainau. Am 26. Oktober wurde in einem Festgottesdienst der bisherige 2. Pfarrer Hans Stettner in das Amt des 1. Pfarrers eingeführt. Fast ein ganzes Jahr blieb die 2. Pfarrstelle unbesetzt. Am 25. Juli 1976 wurde dann der Missionar und Pfarrer Eckard Weber als 2. Pfarrer von St. Johannes installiert.
Im Herbst 1975 konnte ein Mitarbeiterteam für Gemeindebrief (Verteilung) und Besuchsdienst von insgesamt ca. 40 erwachsenen Gemeindegliedern gewonnen werden. Im nächsten Frühjahr konnten die ersten Mitarbeiter zu einer Tagung für Besuchsdienst nach Selbitz geschickt werden.